Kritikfähigkeit bei Kindern und Erzieherinnen: Warum Zuhören, Verstehen und Wachsen zusammengehören
- Martha Kwiaton
- 24. Okt. 2025
- 2 Min. Lesezeit

Was bedeutet Kritikfähigkeit eigentlich?
Kritikfähigkeit beschreibt die Fähigkeit, Rückmeldungen anzunehmen, darüber nachzudenken und daraus zu lernen – ohne sich dabei persönlich angegriffen zu fühlen. Sie ist eng verbunden mit Selbstreflexion und Empathie, denn wer Kritik annehmen kann, lernt sich selbst und andere besser zu verstehen.
Für Kinder bedeutet Kritikfähigkeit nicht, Fehler vermeiden zu müssen, sondern zu erleben: Ich darf etwas falsch machen – und trotzdem bin ich wertvoll. Wenn Erwachsene diese Haltung vorleben, entsteht eine Atmosphäre, in der Lernen und Weiterentwicklung selbstverständlich werden.
Ein Beispiel aus dem Alltag
Wenn Kolleginnen Feedback geben oder Konflikte entstehen, versuche ich bewusst zuzuhören – ohne mich sofort zu rechtfertigen. Ich nehme mir Zeit, um über das Gesagte nachzudenken und daraus zu lernen. So entsteht Raum für Entwicklung – sowohl persönlich als auch im Team.
Für die Kinder bedeutet das, dass sie ein Umfeld erleben, in dem Offenheit und gegenseitiger Respekt gelebt werden. Ein Team, das sich reflektiert und miteinander wächst, kann Kinder authentisch begleiten und ihnen die bestmögliche Unterstützung bieten.
Kritikfähigkeit heißt für mich, ehrlich hinzuschauen, Rückmeldungen anzunehmen und sie als Chance zu nutzen – für mich selbst, mein Team und das gemeinsame Lernen im Alltag.
Warum Kritikfähigkeit für Kinder so wichtig ist
Kritikfähigkeit fördert die emotionale Reife und stärkt die Beziehung zu anderen. Kinder, die lernen, Feedback als Chance zu sehen, entwickeln Vertrauen in ihre Fähigkeiten und bleiben neugierig auf Neues.
Wenn Erwachsene Rückmeldungen einfühlsam und wertschätzend formulieren, vermitteln sie: Du darfst Fehler machen, und du darfst daraus lernen. Das schafft Mut, Verantwortung zu übernehmen und eigene Grenzen zu erkennen.

Kritikfähigkeit beginnt bei den Erwachsenen
Im Kita-Alltag ist Kritikfähigkeit ein wesentlicher Bestandteil professioneller Haltung – sei es im Austausch mit Kolleginnen, in Elterngesprächen oder in der Reflexion des eigenen Handelns. Sie zeigt sich in der Bereitschaft, zuzuhören, eigene Standpunkte zu prüfen und Veränderungen zuzulassen.
Das heißt konkret:
Zuhören: Rückmeldungen annehmen, ohne sofort zu rechtfertigen.
Nachdenken: Eigene Reaktionen und Entscheidungen hinterfragen.
Dialog suchen: Gemeinsam Lösungen entwickeln statt Schuld zu verteilen.
Dazulernen: Kritik als Möglichkeit zur Weiterentwicklung verstehen.
Warum Erzieherinnen Kritikfähigkeit bewusst leben sollten
Kritikfähigkeit ist ein Zeichen von Stärke – nicht von Schwäche. Wer sich selbst hinterfragt, zeigt Kindern, dass Lernen ein lebenslanger Prozess ist.
Vorbildfunktion: Kinder erleben, dass Fehler keine Niederlage sind, sondern Lernchancen.
Qualitätssteigerung: Konstruktive Rückmeldungen verbessern Abläufe und Beziehungen.
Teamkultur: Eine offene Haltung im Kollegium fördert Vertrauen, Respekt und Zusammenhalt.
Kritikfähigkeit als gemeinsamer Prozess
Kinder und Erwachsene wachsen gemeinsam an Rückmeldungen – wenn Kritik ehrlich, respektvoll und lösungsorientiert bleibt. In einer Kultur, in der jeder gehört wird, entsteht Raum für Entwicklung und gegenseitiges Verständnis.
Kritikfähigkeit bedeutet nicht, alles hinzunehmen, sondern bewusst zu prüfen, was hilfreich ist. Sie stärkt das Selbstbewusstsein, vertieft Beziehungen und öffnet den Blick für neue Perspektiven. Oft sind es gerade die leisen Gespräche nach einer Auseinandersetzung, in denen echtes Lernen geschieht.
Kritikfähigkeit bedeutet, im Dialog zu bleiben – mit sich selbst und anderen. Sie schafft Vertrauen, stärkt Beziehungen und eröffnet die Möglichkeit, gemeinsam zu wachsen.
Quellen:
Hüther, G. (2011). Etwas mehr Hirn, bitte.
Oerter, R. & Dreher, E. (2008). Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters.
Eigene pädagogische Praxis und Teamreflexion
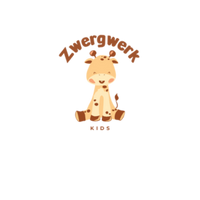





Kommentare