Lernbereitschaft bei Kindern und Erzieherinnen: Wie Neugier wächst und Entwicklung gelingt
- Martha Kwiaton
- 7. Aug. 2025
- 2 Min. Lesezeit

Was bedeutet Lernbereitschaft eigentlich?
Lernbereitschaft beschreibt die innere Haltung, offen für neue Erfahrungen zu sein, neugierig Fragen zu stellen und Herausforderungen anzunehmen – aus eigenem Antrieb heraus. Sie ist kein dauerhafter Zustand, sondern wird durch die Umgebung, Beziehungen und emotionale Sicherheit gefördert.
Für Kinder zeigt sich Lernbereitschaft zum Beispiel darin, wenn sie Dinge ausprobieren, selbst nach Lösungen suchen oder sich mit Begeisterung auf eine neue Aufgabe einlassen. Damit das gelingt, braucht es Erwachsene, die ihnen diesen Raum geben – und ihn auch selbst mit Leben füllen.
Ein Beispiel aus der Praxis
Beim gemeinsamen Teamgespräch erzählte mir eine Kollegin von einem neuen Ansatz zur Sprachförderung. Früher hätte ich vielleicht gedacht: Ich mache es so wie immer – das funktioniert doch.Aber ich habe es ausprobiert und gemerkt, wie gut die Kinder darauf reagieren, weil der Ansatz viel spielerischer ist und sie so besser motiviert werden. Diese Offenheit hat nicht nur meinen Blick erweitert, sondern auch neue Impulse in die Arbeit mit den Kindern gebracht.
Lernbereitschaft beginnt also nicht bei den Kindern, sondern bei uns Erwachsenen – und zeigt sich oft in kleinen, alltäglichen Situationen.
Warum Lernbereitschaft für Kinder so wichtig ist
Kinder begegnen täglich Herausforderungen – ein schwieriges Puzzle, ein Streit mit Freunden, eine neue Spielidee. Lernbereitschaft hilft ihnen, sich auf diese Situationen einzulassen, auch wenn sie nicht sofort eine Lösung parat haben. Sie lernen, dass Fehler erlaubt sind und dass es spannend ist, Neues auszuprobieren.
Doch das gelingt nur, wenn sie sich sicher fühlen – wenn sie spüren, dass ihre Fragen willkommen sind und sie nicht bewertet werden. Eine lernbereite Haltung braucht emotionale Sicherheit.
Lernbereitschaft beginnt bei den Erwachsenen
Erzieherinnen begleiten Kinder beim Entdecken der Welt. Sie prägen durch ihr Verhalten, ob Kinder sich trauen, Fragen zu stellen, etwas auszuprobieren oder einfach nur zuzuhören. Doch auch Fachkräfte selbst brauchen Lernbereitschaft – denn der Kita-Alltag stellt sie ständig vor neue Situationen, Perspektiven und Herausforderungen.

Was bedeutet das konkret?
Offenheit: Neue pädagogische Impulse annehmen – auch wenn sie den gewohnten Rahmen verlassen.
Selbstreflexion: Das eigene Handeln hinterfragen – nicht aus Unsicherheit, sondern aus echtem Interesse an Weiterentwicklung.
Fehlerfreundlichkeit: Mut, Dinge auszuprobieren, auch wenn nicht alles sofort klappt.
Freude am Mitlernen: Gemeinsam mit Kindern forschen, entdecken und staunen – ohne alles vorzugeben.
Warum Erzieherinnen Lernbereitschaft bewusst leben sollten
Lernbereitschaft ist ansteckend. Wenn Kinder erleben, dass Erwachsene selbst neugierig, offen und flexibel sind, übernehmen sie diese Haltung ganz selbstverständlich.
Vorbildfunktion: Kinder beobachten, wie wir mit Neuem umgehen.
Vielfalt anerkennen: In heterogenen Gruppen ist es wichtig, offen für unterschiedliche Sichtweisen und Bedürfnisse zu bleiben.
Teamarbeit stärken: Ein lernbereites Team profitiert voneinander – durch Austausch, gegenseitige Inspiration und gemeinsame Weiterentwicklung.
Lernbereitschaft als gemeinsamer Prozess
Kinder und Erwachsene lernen nie losgelöst voneinander. Wenn Erzieherinnen bereit sind, sich auf Neues einzulassen, entsteht ein Raum, in dem auch Kinder ihre natürliche Neugier entfalten dürfen. Lernbereitschaft ist keine Technik, sondern eine Haltung – und sie wächst, wenn wir ihr bewusst Raum geben.
Verbesserte Lebensqualität durch gelebte Neugier und Entwicklung im Alltag von Kindern und Fachkräften.
Quellen:
Hüther, G. (2012). Wie aus Kindern glückliche Erwachsene werden.
Laevers, F. (2005). Well-being and Involvement in Care Settings.
Eigene pädagogische Praxis und Teamreflexion
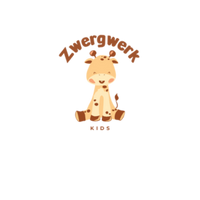





Kommentare