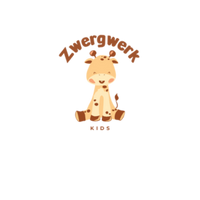Wenn aus einem Moment ein Prozess wird – Transitionen verstehen und gestalten
- Martha Kwiaton
- 3. Juli 2025
- 3 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Juli 2025

Übergang oder Transition? – Eine Begriffsklärung
In der pädagogischen Arbeit mit Kindern ist es entscheidend, zwischen einem „Übergang“ und einer „Transition“ zu unterscheiden. Ein Übergang bezeichnet meist ein einzelnes Ereignis, wie den ersten Tag im Kindergarten oder den Wechsel von der Krippe in die Kita. Eine Transition hingegen beschreibt den gesamten Prozess der Anpassung – emotional, sozial und entwicklungspsychologisch –, den ein Kind durchläuft, wenn es mit neuen Lebensumständen konfrontiert wird. Diese Übergangsphasen sind daher keine punktuellen Ereignisse, sondern begleiten das Kind über einen längeren Zeitraum. Dabei werden nicht nur die Kinder selbst, sondern auch ihr Umfeld, etwa Familie und pädagogische Fachkräfte, herausgefordert und verändert. Aus meiner langjährigen Erfahrung als Gruppenleitung weiß ich, wie wichtig es ist, diese Transitionen ganzheitlich zu betrachten. So habe ich einmal erlebt, wie ein Kind aus einem anderen Kulturkreis zu uns kam. Die Eltern waren sehr unsicher und übertrugen ihre Ängste spürbar auf das Kind. Diese Situation zeigte mir deutlich, dass wir nicht nur das Kind, sondern auch die Eltern in solchen Phasen geduldig und mit viel Einfühlungsvermögen begleiten müssen. ________________________________________
Modelle der Eingewöhnung: Berliner & Münchener Ansatz
Um Kinder und Familien während der Transition gezielt zu unterstützen, gibt es verschiedene Eingewöhnungsmodelle. Besonders bekannt sind das Berliner und das Münchener Modell. Das Berliner Modell basiert auf der Bindungstheorie. Hier sind die Eltern in den ersten Tagen aktiv bei der Eingewöhnung dabei, bevor die Trennung vom Kind schrittweise aufgebaut wird. Die Beobachtung des Kindes steht dabei im Mittelpunkt: Wie reagiert es auf die Nähe und die Trennung von den Eltern? Das Münchener Modell legt mehr Wert auf die Individualität jeder Familie. Zeitliche Vorgaben sind hier weniger strikt, und es wird stärker auf die Bedürfnisse des Kindes und seiner Bezugspersonen eingegangen. Die Eingewöhnung wird als gemeinsamer Prozess verstanden. Ich kombiniere in der Praxis oft beide Modelle. So zum Beispiel bei einem Kind, das anfangs sehr unruhig und ängstlich war. Wir führten morgens ein kleines Ritual ein: Das gemeinsame Öffnen des Fensters, um „gute Gedanken“ hereinzulassen. Dieses Symbol half dem Kind, sich zu beruhigen und mir, die Trennung sanft zu gestalten.
________________________________________
Pädagogische Kompetenzen in der Begleitung von Transitionen
Neben Modellen sind vor allem pädagogische Kompetenzen für eine gelungene Transition wichtig:
• Resilienz fördern: Kinder brauchen emotionale Sicherheit, um mit Veränderungen umzugehen. Stabile Strukturen und liebevolle Begleitung schaffen diese Sicherheit.
• Selbstwert stärken: Erfolgserlebnisse in kleinen Schritten bauen das Vertrauen der Kinder auf und helfen ihnen, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden.
• Emotionale Stabilität zeigen: Als Fachkraft bin ich Vorbild. Meine ruhige und empathische Haltung hilft den Kindern, sich sicher zu fühlen. Ich erinnere mich an ein Mädchen in meiner Gruppe, das sich anfangs oft zurückzog. Statt sie zu drängen, habe ich ihr kleine Aufgaben gegeben, wie etwa eine Pflanze zu gießen. Schritt für Schritt wuchs so ihr Vertrauen und ihre Neugier.
________________________________________
Reflexion aus der Praxis: Übergänge lesen lernen

Am wichtigsten ist es, aufmerksam auf die leisen Signale der Kinder zu achten. Oft sind diese sehr subtil und erfordern eine sensible Wahrnehmung. So habe ich einmal einen Jungen erlebt, der anfangs jeden Morgen schweigend in der Garderobe saß und keinen Blickkontakt suchte. Ich setzte mich einfach zu ihm, ohne etwas zu erwarten. Nach einigen Tagen begann er, sich zu öffnen und zeigte langsam Interesse. Für mich war das der Moment, in dem seine Transition wirklich begann. Solche leisen Übergänge sind oft die tiefgründigsten – sie geschehen im Stillen und erfordern viel Feingefühl.
________________________________________
Verbesserte Lebensqualität durch pädagogisches Wissen mit Herz. ________________________________________
Quellen
Griebel, W., & Niesel, R. (2006). Transitionen im Kindergarten.
Laewen, H.-J., Andres, B., Hédervári-Heller, E. (2003). Die Eingewöhnung von Kindern unter drei Jahren. Das Berliner Modell.
Wustmann, C. (2007). Eingewöhnung in Krippe und Kita. Das Münchener Modell. Textor, M.R. (2000). Resilienz im pädagogischen Alltag.
Eigene pädagogische Einschätzung, Erfahrung und Reflexion.